Dr. Peter Lodermeyer
Die Malerei von Uta Weil weist eine unverkennbare Nähe zum Thema Landschaft auf, das gilt selbst für jene Bilder, die überhaupt keinen direkten Bezug zu tatsächlichen Landschaftserlebnissen haben. Sie sind gleichsam proto-landschaftlich und bieten ihren Betrachtern fast immer gewisse Anhaltspunkte, die ihn oder sie zu einem aktiven Sehen ermuntern, bei dem Landschaftliches weniger gezeigt als vielmehr in der Vorstellung evoziert oder aus der Erinnerung abgerufen wird. Dem kommt die Tatsache entgegen, dass die Arbeiten üblicherweise keine Titel tragen und so die Vorstellungskraft der Beschauer nicht vorschnell in eine Richtung lenken. Es ist kein Zufall, dass die Bilder von Uta Weil – von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen – allesamt Querformate sind. Das horizontal gestreckte Format zeigt ja von sich aus schon die Tendenz, Landschaftsschemata aufzurufen. Das liegt nicht nur an der kulturellen Prägung durch ungezählte Landschaftsbilder, die man gesehen hat, sondern ist zweifellos schon physiologisch durch unser in die Breite gestrecktes binokulares Gesichtsfeld vorgeprägt, mit dem wir auf die Welt schauen, ein Feld, in dem im Freien gewöhnlich das Gesehene von einer Horizontlinie in unterschiedliche Zonen geteilt wird, zumindest in Erde und Himmel. Uta Weil nutzt diese sich unbewusst einstellenden Schemata für ihre Malerei – aber es wäre verfehlt, ihre Bilder schlicht als Landschaftsdarstellungen zu bezeichnen. Das hat weniger mit den Motiven (oder Quasi-Motiven) ihrer Bilder zu tun als mit den formalen Mitteln, die für ihre Kunst charakteristisch sind. Die Besonderheit ihrer Arbeiten liegt eben darin, dass bei ihnen die inhaltlichen und die formalen Aspekte – sofern es überhaupt möglich ist, beides sauber zu trennen – eine Polarität markieren, aus der sie ihre spezifische Spannung generieren.
Ein erstes Beispiel soll dies verdeutlichen, ein kleines, 21 x 30 Zentimeter messendes Blatt von 2018, auf dem alle drei Primärfarben einen Auftritt haben und sich in unterschiedlichem Maße gegenseitig durchdringen. Wo sich Gelb und Blau überlagern und die Mischfarbe Grün erzeugen, ist man als Betrachter schnell davon überzeugt, einen Wald an zwei zu den Seiten aufsteigenden Hügeln zu sehen, darüber ein in der Ferne verblauendes Hochgebirge. Etwas oberhalb der Bildmitte verläuft eine horizontale Linie, deren Lesart als Uferlinie eines Sees sich geradezu aufdrängt, zumal der weit nach unten ausschwingende Bogen der gelben Farbe einigermaßen spiegelsymmetrisch die blaue Kurve oben reflektiert. Doch wer das Blatt nur als abstrahierte Landschaft mit Bergsee begreift, hat das Bild noch gar nicht gesehen. Sein besonderer Reiz liegt ja eben darin, dass es das Landschaftsschema aufruft, bei genauerer Betrachtung aber infragestellt, ja im Grunde sogar wieder auflöst. Wenn man einmal die großen Schwünge der Primärfarben Rot, Gelb und Blau analytisch auseinandergehalten und in ihrem Zusammenspiel verstanden hat, kann man sich auf die Details konzentrieren. Dabei ist festzustellen, dass sich in der unteren rechten Ecke, im Orange-Rot-Spektrum, die meisten kleinteiligen Einzelformen finden lassen: scharfe Konturen, fadendünne Linien, Farbmischungen mit ausgefransten Trocknungsspuren. Im Landschaftszusammenhang müsste dies alles auf einer sich in die Bildtiefe hinein erstreckenden Wasseroberfläche abspielen; offenkundig handelt es sich dabei aber im Gegenteil um malerische Farbereignisse auf der Bildfläche selbst. Dies bedeutet, dass die Autonomie des dynamischen Farbauftrags sich nicht in das Landschaftsschema einordnen lässt und es somit konterkariert.

Während „Landschaft“ als schematische Vorstellung ein relativ stabiles bildliches Gerüst bietet, erweist sich der Farbauftrag bei Uta Weil im Gegenteil als betont dynamisch, flüssig, transitorisch. Aus der Dialektik von beidem leben viele ihrer Bilder. Die Künstlerin verwendet die Acrylfarbe stark verdünnt, durchscheinend wie zarte Schleier. Uta Weil mag offensichtlich keine opaken, einander und das Papierweiß verdeckende Farbaufträge, keine pastöse Struktur, keine Haptik, keine die Handschrift bewahrende Materialität. Ihre Farbe ist meist leicht wie ein Hauch, in rascher Bewegung aufgetragen und durchlichtet vom Bildträger, dessen Leerstellen unverzichtbare Mitspieler im Erscheinungsbild der meisten ihrer Blätter sind. Und die Malerin gibt der Farbe immer die Freiheit, in ihrer nur bedingt steuerbaren Eigenbewegung unerwartete Mikrostrukturen auszubilden, Farbmischungen und detailscharfe Bezirke, die den Blick auf sich ziehen und zu einem close reading anregen. Ein weiteres Beispiel: ein Bild von 2015, bei dem die Farbigkeit von oben nach unten von einem fast immateriellen Blau nach unten hin graduell in einen eher kühl wirkenden Rot-Ton übergeht. Während am oberen Bildrand eie weit ausschwingende Sinuskurven alpine Formen suggerieren, scheint am unteren Ende eine breite, von freien weißen Linien durchsetzte Pinselspur wie ein Gletschergeschiebe in fulminanter Bewegung von links nach rechts zu driften. Berge und Gletscher, diese Landschaftselemente drängen sich als Vergleich auf – und dennoch hat diese Arbeit nicht im Geringsten mit der Wiedergabe gesehener Landschaft zu tun. Es sind eher erinnerte als visuell wahrgenommene Landschaften, Allusionen statt Mimesis. Die „Natur“, wie sie in Uta Weils Bildern aufscheint, besteht nicht aus in Formen verfestigten Strukturen, sie erweist sich vielmehr als eine in stetem Werden begriffene Kraft: natura naturans, nicht natura naturata.

Die Prozessualität der Bilder (die übrigens auch ein prozesshaftes, die Bildgegebenheiten nach und nach freilegendes Sehen erfordert), ihr Hervorkommen aus der gestischen Bewegung der Hand und den Fließ- und Trocknungseigenschaften des Farbmaterials selbst, ist auch jenen Arbeiten eigen, die keinen oder zumindest keinen zwingenden Landschaftsbezug aufweisen. Eine kleine Arbeit in Rot und Grün mit zarten Bleistiftspuren, 2018 entstanden, macht dies deutlich. Das rote Formengefüge aus wuchtigen Balken, die auf der rechten Seite einen V-förmigen Spalt aufweisen, erscheint links unten mit seinen spielerisch eingetragenen Kringeln eher improvisatorisch belebt. Geradezu zufällig verteilt wirken hingegen die grünen Farbflecken, die sich am unteren Bildrand einstellen –, bis man zwei extrem dünne, schnurgerade verlaufende, vielfach unterbrochene grüne Linien bemerkt, eine vom unteren, eine vom rechten Bildrand ausgehend, die sich rechts, etwas oberhalb der gedachten horizontalen Mittellinie, schneiden. Angesichts dieser unerwartet strengen Linearität inmitten der aleatorischen Verteilung des Grün stellt sich unmittelbar die Frage nach ihrem Zustandekommen – ohne dass das Blatt darauf eine Antwort gibt. Ebenso muss offen bleiben, ob die wie absichtslos aufgetragenen Bleistiftspuren so etwas wie eine skizzenhafte Vorgabe für die farbige Ausgestaltung gewesen sind oder umgekehrt ein linearer Kommentar zu dem Farbgeschehen selbst.

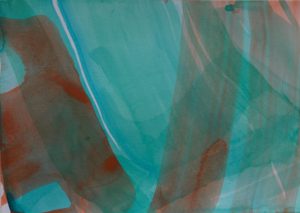
Eine ganz andere Fokussierung des Blicks geschieht angesichts solcher Blätter, bei denen Uta Weil das Landschaftsschemata vermeidet und ein vollflächiger Farbauftrag die sonst üblichen Leerstellen des Blattes ausschließt. Wie ein Bild von 2019 zeigt, stellt sich dort dennoch geradezu unvermeidlich die Assoziation von Natur ein. Wie bei einem senkrechten Blick aus nächster Nähe auf eine Wasseroberfläche erscheinen dort verfließende rötlich-braune Formen in einem das gesamte Bildfeld überflutenden Blau. Ein komplexes Zusammenspiel von Transparenzstufen, Überlagerungen und unterschiedlichen Fließrichtungen: Farbe als Naturereignis.
© 2019 Peter Lodermeyer